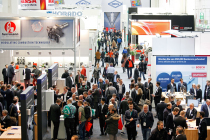Raumklima deutscher Schulen erfordert Handlungsbedarf
Bereits 2015 zeigte eine Studie des Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die Umgebungsbedingungen in Klassenzimmern zwar grundsätzlich kontinuierlich verbessert haben, in der Praxis jedoch nur selten optimal betriebene Räumlichkeiten in Schulbauten vorzufinden sind. Eine Tatsache, die bis heute in Deutschland und vielen Nachbarländern besteht, wie eine aktuelle Studie der Freien Universität Bozen bestätigt. So ist in Deutschland momentan in lediglich 10 % der annähernd 48.000 Schulen eine raumlufttechnische Anlage verbaut. Vielen kommunalen Schulträgern fehlen die finanziellen Mittel für eine energieeffiziente Lüftungsanlage und damit zur Sicherung einer ausreichenden Innenraumluftqualität.
„Zur Vermeidung der Übertragung durch Aerosole sind in geschlossenen und dicht besetzten Räumen Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und Masken allein nicht ausreichend“, verweist Dr. Thomas Schräder, Geschäftsführer des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik, auf Untersuchungen des Hermann-Rietschel-Instituts. „Ohne effektiven Luftaustausch besteht grundsätzlich die Gefahr einer kritischen Ausbreitung von virenbehafteten Aerosolen im Raum. Die Empfehlung der mehrmaligen Stoß- beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster kann hierbei nur eine kurzfristige Maßnahme darstellen.“ Eine dauerhafte Lösung sieht Schräder im Betrieb moderner Lüftungs- und Klimaanlagen, die das definierte Einbringen von frischer Außenluft und das Abführen belasteter Raumluft gewährleisten. In diesem Zusammenhang bietet die Informationsschrift „Betrieb und Nutzung von lüftungstechnischen Anlagen in Zeiten von COVID-19“ des Arbeitskreises Luftfilter im VDMA einen Überblick über die wichtigsten Aspekte zur Risiko-Minimierung der Ausbreitung von COVID-19 durch richtige Nutzung lüftungstechnischer Anlagen. Welches Risikopotential Standard-Klassenzimmer in sich bergen und welchen Stellenwert eine mechanische Lüftung hat, haben Wissenschaftler der RWTH Aachen anhand einer vereinfachten Modellrechnung und dem Vergleich mit einer Wohnung aufgezeigt. Hierbei ergeben analoge Luftwechselraten in Klassenzimmer und Wohnung, für einen mit 35 Personen vollbesetzten Klassenraum, verglichen mit der Wohnung, ein zwölfmal höheres Infektionsrisiko. Die Analyse zeigt, dass in Klassenräumen, in Anbetracht der hohen Belegungsdichten und Aufenthaltsdauern, hohe Luftwechselraten erforderlich sind, um ein niedriges Infektionsrisiko zu gewährleisten. Kurzfristig sollte in der Praxis zumindest eine CO2-Ampel als Indikator für die personenbezogene Außenluftmenge verwendet werden.